Welche wichtige BGH Urteile gibt es zum Thema Patientenverfügung?
Die Urteile des Bundesgerichtshofs (BGH) betonen, dass Patientenverfügungen konkret und klar formuliert sein müssen, um wirksam zu sein. Allgemeine Aussagen wie „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ reichen nicht aus; es müssen konkrete medizinische Maßnahmen und Behandlungssituationen beschrieben werden. Zudem sollten Widersprüche vermieden und die Verfügung regelmäßig aktualisiert werden, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.
- Das Urteil von 2016: Warum Allgemeinheiten nicht ausreichen
- 2017: Konkrete Behandlungssituationen beschreiben
- 2018: Der Sterbewunsch im Fokus
- 2019: Keine Haftung bei fehlender Verfügung
- So erstellen Sie eine BGH-sichere Patientenverfügung
- Rechtliche Absicherung: Das sollten Sie zusätzlich tun
- Häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden
Der Bundesgerichtshof hat in mehreren Grundsatzentscheidungen klare Regeln für wirksame Patientenverfügungen festgelegt. Diese Urteile helfen Ihnen, rechtssicher vorzusorgen - damit Ihre Wünsche im Ernstfall respektiert werden.
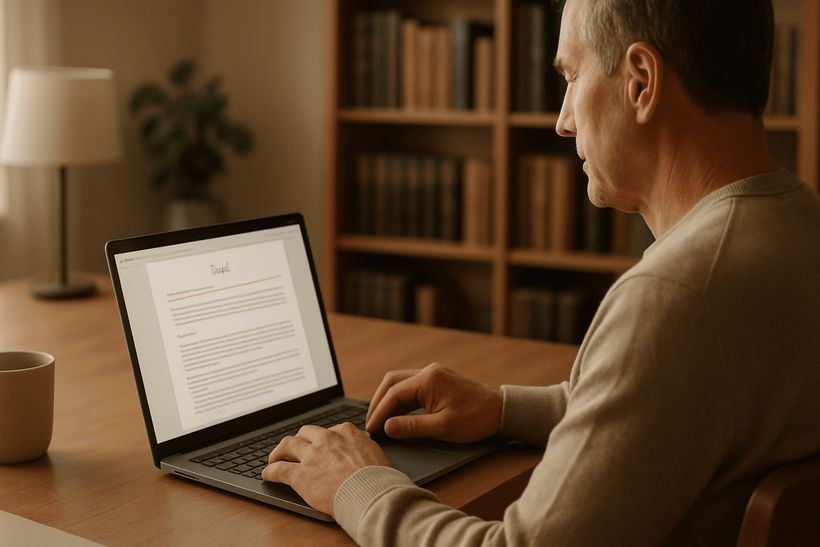
Das Urteil von 2016: Warum Allgemeinheiten nicht ausreichen
Im Juli 2016 entschied der BGH (XII ZB 61/16), dass pauschale Formulierungen wie „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ nicht ausreichen[1][3][8]. Hintergrund war der Fall einer Frau, die nach einem Hirnschlag künstlich ernährt wurde. Ihre Verfügung enthielt keine konkreten Angaben zur Ernährungssonde, was zu familieninternen Konflikten führte[8].
Praktische Folge: Seit diesem Urteil müssen Sie in Ihrer Patientenverfügung einzelne medizinische Maßnahmen benennen - etwa „Verzicht auf Beatmungsgerät“ oder „Keine Wiederbelebung bei Herzstillstand“. Allgemeine Aussagen zum Sterbewunsch gelten nicht als ausreichend konkret[3][6].
2017: Konkrete Behandlungssituationen beschreiben
Im Februar 2017 präzisierte der BGH (XII ZB 604/15) die Anforderungen: Entscheidend ist die Kombination aus konkreten Maßnahmen und klaren Behandlungsszenarien[2][4][9]. Im entschiedenen Fall hatte eine Patientin festgehalten, bei irreversiblen Hirnschäden auf lebensverlängernde Maßnahmen zu verzichten. Der BGH bestätigte, dass diese Formulierung trotz fehlender Einzelmaßnahmen ausreicht, weil sie einen klaren Bezug zur konkreten Situation herstellt[4][5].
Das bedeutet für Sie:
- Beschreiben Sie medizinische Zustände wie „fortgeschrittene Demenz ohne Kommunikationsfähigkeit“
- Verknüpfen Sie diese mit konkreten Behandlungsverzichten wie „Keine Antibiotikagabe bei Lungenentzündung“
- Nutzen Sie Beispielformulierungen des Bundesjustizministeriums als Orientierung[3][6]
2018: Der Sterbewunsch im Fokus
Ein Novemberurteil 2018 (XII ZB 107/18) klärte, wie mit scheinbaren Widersprüchen umzugehen ist[3][7]. Eine Patientin hatte aktive Sterbehilfe abgelehnt, gleichzeitig aber den Abbruch künstlicher Ernährung bei fehlender Bewusstseinsrückkehr gewünscht. Der BGH wertete dies als klaren Patientenwillen und betonte:
Auch bei unpräzisen Formulierungen müssen Ärzt:innen und Gerichte den Gesamtkontext berücksichtigen - inklusive früherer Äußerungen und Zeugenaussagen.[3][7]
Praxistipp: Dokumentieren Sie zusätzlich zur Patientenverfügung Gespräche mit Vertrauenspersonen, die Ihren Willen bestätigen können[1][7].
2019: Keine Haftung bei fehlender Verfügung
Ein Aprilurteil 2019 (VI ZR 13/18) stellte klar: Ärzt:innen haften nicht für lebensverlängernde Maßnahmen, wenn keine Patientenverfügung existiert[10]. Selbst bei schwersten Leiden ohne Heilungschance gilt das Weiterleben nicht als „Schaden“ im Rechtssinn.
Konsequenz: Ohne konkrete Verfügung entscheiden Ärzt:innen und Angehörige nach eigenem Ermessen - ein Risiko, das Sie durch klare Vorsorge vermeiden können[10].
So erstellen Sie eine BGH-sichere Patientenverfügung
Konkrete Maßnahmen benennen
Vermeiden Sie Oberbegriffe wie „lebenserhaltende Maßnahmen“. Listen Sie stattdessen auf:- Künstliche Beatmung
- Dialyse
- Chemotherapie
- Antibiotikagabe bei Infektionen[3][6]
Behandlungsszenarien beschreiben
Formulieren Sie Bedingungen wie:- „Bei dauerhaftem Verlust der Entscheidungsfähigkeit durch Demenz“
- „Nach schwerem Schlaganfall ohne Aussicht auf Rehabilitation“[4][5]
Widersprüche vermeiden
Klären Sie in separaten Absätzen:- Verhältnis zur Sterbehilfe
- Schmerztherapie trotz Lebensverkürzung
- Organspenden-Regelung[3][7]
Regelmäßig aktualisieren
Überprüfen Sie Ihre Verfügung alle 2 Jahre auf:
Rechtliche Absicherung: Das sollten Sie zusätzlich tun
Kombinieren Sie mit Vorsorgevollmacht
Benennen Sie eine Person, die Ihre Wünsche durchsetzt (§ 1827 BGB)[3][7]Arztgespräch dokumentieren
Lassen Sie sich die Verfügung von Ihrer Hausarztpraxis bestätigen - das stärkt die Beweiskraft[6][8]Verteilen Sie Kopien
Hinterlegen Sie Exemplare bei:
Häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden
❌ „Keine Apparatemedizin“
Diese Formulierung ist zu unkonkret. Benennen Sie stattdessen einzelne Geräte/Verfahren[1][6].
❌ „Im Endstadium jeder Krankheit“
Definieren Sie genau, welche Krankheitsbilder gemeint sind (z.B. „metastasierter Krebs“)[4][5].
❌ Ohne Datum/Unterschrift
Ungültig! Jede Verfügung muss handschriftlich unterzeichnet und datiert sein[3][8].
Mit diesen Erkenntnissen aus der BGH-Rechtsprechung können Sie Ihre Patientenverfügung so gestalten, dass sie im Ernstfall wirksam ist. Nehmen Sie sich Zeit für diese wichtige Vorsorge - sie gibt Ihnen und Ihren Angehörigen Sicherheit in schwierigen Situationen.